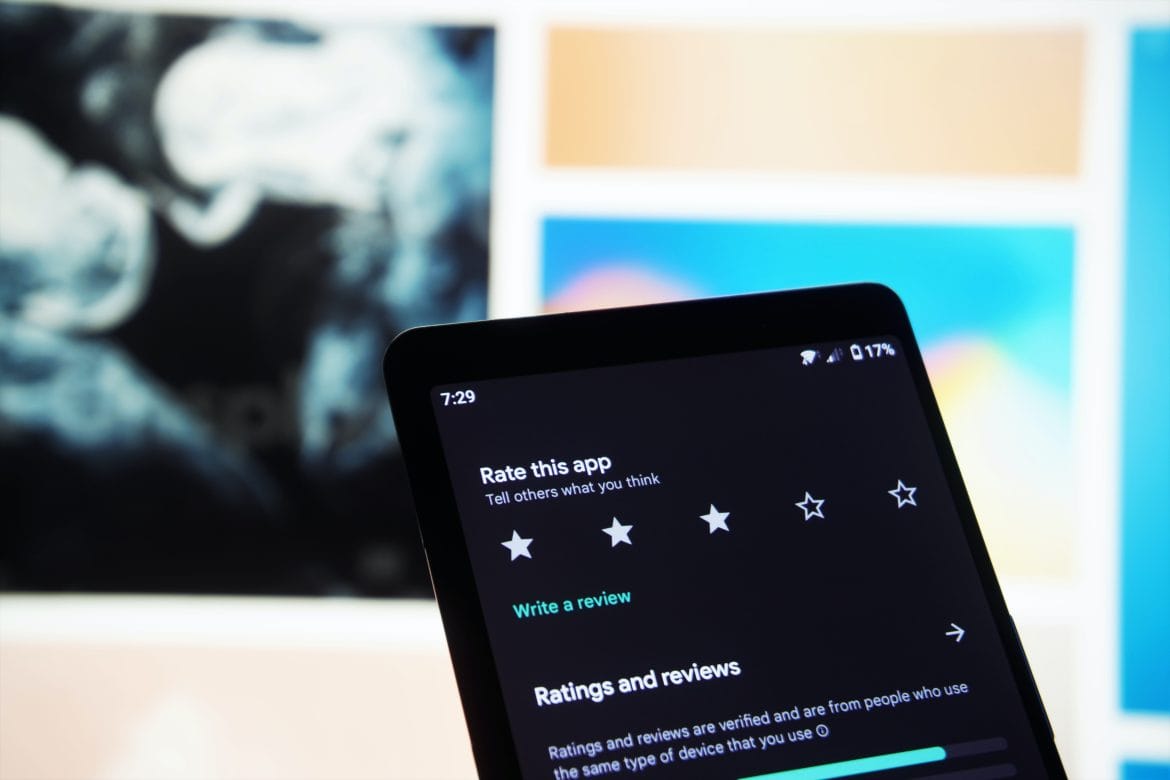Als unsere Urahnen sich vor vielen tausend Jahren in Gruppen zusammenschlossen, um gemeinschaftlich Mammuts zu erledigen, Felder zu bewirtschaften oder nicht einsam in Höhlen vor sich hinzufrösteln, brannte sich eine Denkweise ganz tief in das kleine Steinzeitgehirn. Einerseits hilft eine starke soziale Gruppe immens beim Überleben. Andererseits ist die eigene Position innerhalb dieser Gruppe fast noch wichtiger, um das eigene Überleben und den Fortbestand zu sichern. Die reine Muskelkraft und physische Präsenz wurden im Laufe der Zeit zunehmend von Einfallsreichtum und Innovation abgelöst. Die sozialen Gruppen wurden immer größer, bis sich ganze Gesellschaften bildeten, die ein mehr oder weniger gerechtes Sozialsystem in die Gruppen implementierten. Doch eins konnten die Menschen niemals ablegen: Den Wunsch alles bewerten, vergleichen und einsortieren zu können.
Vom antiken Olympia bis zur Social-Media-Ära
So traten im antiken Griechenland wackere Athleten in olympischen Wettstreiten gegeneinander an, während die Römer dies einige hundert Jahre später in brutalen Gladiatorenkämpfen etwas weniger jugendfrei ausgehen ließen. Im Mittelalter schwangen dann Ritter ihre Lanze Richtung Kontrahent und auf dem Sängerkrieg wurden mit Bratsche und findigen Liedtexten die besten Minnesänger ermittelt. Heute schauen wir uns im Fernsehen Models und Sänger:innen in Castingshows an, während wir uns gehässig kleine fiese Urteile aus der Ferne erlauben. Auf Social Media analysieren wir, wie viele Follower und Abonnentinnen ein Kanal hat und freuen uns bei einer eigenen stattlichen Anzahl an Likes über den vielen Zuspruch aus unserer Filterblase.
Und genauso wie in Schule und Sport Bewertungssysteme durch Spicken, Doping oder andere freche Tricks ab und an umgangen werden, können uns auch im digitalen Raum Betrug und Manipulation begegnen. Die typischen Sterne-Bewertungen, Likes und Kommentare können dabei sowohl authentisch als auch frei erfunden und erlogen sein. Das ewige Dilemma mit den digitalen Medien schlägt also wieder zu, da wir uns der Potentiale und Gefahren bewusst werden müssen. Bewertungssysteme können Vertrauen zum Verkäufer bilden, mögliche Fehlkäufe vermeiden, zusätzliche Informationen bereitstellen und die Produkte und Dienstleistungen verbessern. So stehen schlecht bewertete Ferienunterkünfte meistens länger leer, als den sanierungsmüden Inhabern lieb wäre und sich nach zehnmaliger Benutzung selbstauflösende Produkte werden durch die Wutkommentare ihrer enttäuschten Nutzer zu Ladenhütern.
Bewertungsinstrumente im digitalen Zeitalter
Andererseits können solche Bewertungsinstrumente auch missbraucht werden. Ganze Heerscharen von Kommentator:innen und Social Bots können Produkte und Dienstleistungen über den Klee loben, obwohl die qualitativen Standards bei weitem verfehlt wurden. Gastronomische Einrichtungen können uns digital so einiges auftischen oder auch von unzufriedenen Besuchern in Grund und Boden kommentiert werden. Denn sind wir doch mal ehrlich: Wir kommentieren doch nur, wenn wir entweder etwas extrem gut oder furchtbar schlecht fanden. Eventuell wollen wir den zu Bewerteten auch einfach einen Gefallen tun oder wir werden von affinierten Bewertungssystemen sozial unter Druck gesetzt. So sieht man zum Beispiel beim Buchungsportal für Unterkünfte „AirBnB“ erst dann die Bewertung, wenn man selber auch eine Bewertung abgibt.
Die Jagd nach authentischen Bewertungen in einer Welt der Täuschung
Stiftung Warentest führte im Jahr 2020 einen Test durch, um zu überprüfen, wie leicht man Bewertungen kaufen und manipulieren kann. Dabei kam heraus, dass es Agenturen gibt, die gezielt Kommentatoren für positive Bewertungen bezahlen. Die bezahlten Produktbewerter kriegen dabei ganz klare Ansagen zur Bewertungsabgabe, welche wenig Raum für eigene Meinungen lassen. Das Gütesiegel Trusted Shops hat sich dem Thema auch gewidmet und listet Faktoren auf, wie man Fake-Bewertungen erkennt. Ein Indikator ist zum Beispiel, ob in recht kurzer Zeit übertrieben viele Bewertungen eingegangen sind. Wenn die Bewertungen fast ausschließlich positiv formuliert sind und übertriebenes Lob ausgesprochen wird, kann dies ebenfalls auf Betrug hinweisen. Sobald in Rezensionen Links zu anderen Produkten auftauchen und die Autoren meist nur eine Art von Produkten massiv bewerten ist ebenfalls Vorsicht geboten. Je individueller aber Algorithmen, künstliche Intelligenzen und Sprach-Bots werden, umso schwerer wird es auch, diesen Betrug aufzudecken.
Eine gute Nachricht ist, dass im Jahr 2022 eine Reform des „Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)“ vollzogen wurde. Das verpflichtet Plattformen mit Bewertungssystemen zu mehr Transparenz und Kontrolle. Wird keine Überprüfung der Rezensionen durchgeführt, muss dies ausdrücklich angegeben werden. Auch „die Übermittlung und Beauftragung gefälschter Bewertungen“ ist nun explizit verboten. Die deutschen Parteien haben sich ebenfalls darauf geeinigt keine Social Bots einzusetzen. Zusätzlich reguliert dies das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG), indem es die Betreiber Sozialer Medien dazu dazu verpflichtet, den Einsatz von Social Bots in der politischen Kommunikation zu verhindern.

Medienpädagoge Kay Albrecht. Foto: Kay Albrecht
Als freiberuflicher Pädagoge schult der Erfurter Kay Albrecht die unterschiedlichsten Zielgruppen medienpädagogisch. Regelmäßig klärt Kay in seiner Kolumne im t.akt über Medienphänomene auf, um kritische Zugänge zu den alltäglichen Herausforderungen der medial geprägten Lebenswelt zu legen.